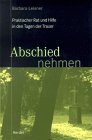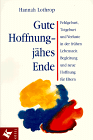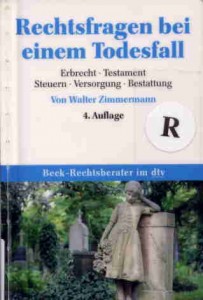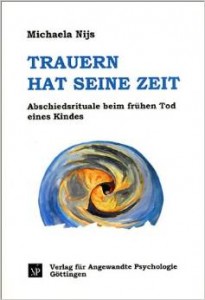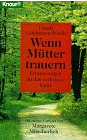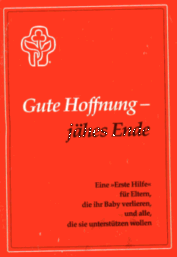Abschiedsrituale beim frühen Tod eines Kindes
Von Michaela Nijs
Auszüge zusammengstellt von Pirko Silke Lehmitz
1.Ritual, Definition und Wirkung
a) Definition für ein Ritual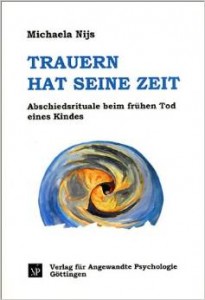
Die amerikanische Psychotherapeutin T. Rando definiert ein Ritual als ein spezifisches Verhalten oder eine spezifische Handlung , die bestimmten Gefühlen und Gedanken des/der Vollziehenden als Einzelner oder als Gruppe symbolischen Ausdruck verleiht. Das Hinaus-Setzen von emotionalen Erlebnisinhalten kann für einen Trauernden befreiend wirken, insbesondere, wenn der Tod eines geliebten Menschen mit traumatischen Erfahrungen verbunden war. Oft fehlen die Worte, um den Schmerz mitzuteilen; dann können Symbole und symbolische Handlung helfen, ohne Worte ein Brücke zu anderen Menschen zu schlagen. Rando weist in ihrer Definition auf ein weiters Charakteristikum von Ritualen hin: sie können einmal stattfinden, wie zum Beispiel eine Beerdigung, sie können jedoch auch wiederholt werden oder über eine gewisse Zeit fortlaufen vollzogen werden. Dies zeigt die vielfältigen möglichen Variationen von Ritualen.
b) Gebrauch des Begriffes Ritual in diesem Buch
Ein Abschiedsritual ist eine bewußt vorbereitete und vollzogene symbolische Handlung, die Gefühle und Gedanken des Trauernden ausdrückt. Diese Handlung ist individuell gestaltet, ihr Inhalt wird geprägt durch die Bedürfnisse und Überzeugungen des trauernden Menschen. Elemente aus überlieferten Ritualen können enthalten sein, eine symbolische Handlung kann auch ohne Anlehnung an Traditionen gestaltet werden. Bei der Vorbereitung und dem Vollzug des Abschiedsrituals dient keine Suggestion oder Manipulation durch andere Menschen statt, das Ritual wird in Freiheit vollzogen. Es kann ein einmaliges Geschehen sein, es kann in derselben Form mehrmals wiederholt werden oder ein fortlaufenden Charakter haben. Die symbolische Handlung ist herausgehoben aus der Routine des Alltags und kann mit Erfahrungen des Außer-Gewöhnlichen verbunden sein. Ein Ritual spricht den ganzen Menschen an, indem es die Aktivität von Körper, Seele und Geist fördert. Ein Ritual wirkt auf verschiedenen ebenen interaktiv. Der Vollzug einer symbolischen Handlung kann eine heilende Wirkung für den Vollziehenden haben.
c) Rituale als Orientierungshilfe
Wenn ein trauernder Mensch vor dem Vollzug eines Abschiedsrituals ein Ziel beschreibe kann, das er unter andrem auch mit Hilfe des Rituals erreichen möchte, kann dieses Ziel eine Orientierung in schwierigen Zeiten bieten. Klare Ziele für Rituale bedeuten nicht, daß quantitativ erfaßbare Leistungen als eine Zieldefinition dienen. Es geht um eine generelle Wegrichtung, nicht um Stationen, die erreicht werden sollen. Eine Mutter kann sich zum Beispiel entscheiden, daran zu arbeiten, wie sie das Gedenken an ihr gestorbenes Kind mehr in ihr Leben integrieren kann. Diese Mutter hat ein klares Ziel: sie möchte ihre Erfahrungen mit dem Leben einbeziehen. Dieses Ziel läßt jedoch offen, welche Wege und Um-Wege gewählt werden und wie die Wegstationen aussehen werden. Das Ziel gibt Orientierung, und gleichzeitig läßt es den Menschen in seinen Entscheidungen frei. Zu diesem frei-lassenden Element der Rituale kommt noch ein weiterer wesentlicher Aspekt hinzu: die Kreativität, das schöpferische Gestalten. Gerade bei den Abschieds-Ritualen, die im vorliegenden Buch dargestellt werden, ist das kreative Element sehr wichtig. Wählt eine Mutter zum Beispiel den fortlaufenden Brief an ihr verstorbenes Kind als seinen möglichen Weg zur besseren Integration ihrer Erfahrungen, dann wird sie nicht jeweils zu Beginn des Schreibens genau definieren, was sie schreiben will. Da das Scheiben ein kreativer Prozeß? Ist, wird sie möglicherweise Gefühle verbalisieren, die ihr vorher nicht bewußte waren, oder sie Zusammenhänge zwischen früheren Erlebnissen und gegenwärtigen Situationen erkennen, die sie auf einer Intellektuellen Ebene vorher nicht hatte sehen können. Sich dem Fluß des Schreibens anzuvertrauen, ohne dabei die Kontrolle durch das Ich zu verlieren – das ist schöpferische Gestaltung von Abschiedshandlungen.
d)Heilende Wirkung
Beim Vollzug eines Rituals erfolgt ein Rückbezug auf das, was nährt und heilt. Diese Nährende verstehe ich im übertragenden Sinn als eine Quelle der Lebenskraft, vielleicht auch als einen imaginativen Ort, an dem ein Mensch sich rückbesinnen kann auf seine wahren Lebensimpulse. Die Annahme dieser kraftspendenen und damit heilenden Wirkung von Ritualen gehört zu den Grundlagen des vorliegenden Buches.
Die amerikanische Psychotherapeutin Achterberg beschreibt die Wirkungen, die Rituale für den einzelnen und für die Gemeinschaft haben können: „Rituale dienen als Wegweiser und Verhaltensmaßstäbe in Krisenzeiten, wenn Körper, Geist oder Seele angegriffen sind. Der Akt des Rituals ermöglicht es den Menschen, Erfahrungen miteinander zu teilen und einander sichtbar zu unterstützend. „Die wesentliche psychologische Wirkung des Rituals liegt darin, daß es Menschen durch schwierige Zeiten geleitet, Sterbend, Schwerkranke, Menschen in emotionalen Krisen. Das Ritual liefert eine Landkarte für das unsichtbare, unbekannte und nicht vermessen Territorium, das sie durchschreiten“.
Als weitere Wirkungen von Ritualen nennt Achterberg die Minderung des Gefühls der Entfremdung von der eigenen Gemeinschaft und die Verminderung von Depressionen und Angst. Die Aufhellung von Depressionen hängt damit zusammen, daß im Ritual die eigene Aktivität des Menschen gefordert ist. Gelingt der Schritt, die Impulse aus dem Denken in eine Handlunge umzusetzen, dann ist der Teufelskreis der depressiven Lähmung durchbrochen.
Ein Mensch kann Hoffnung in einer Krisenzeit erleben, wenn er spürt, daß er sein Hier und Jetzt gestalten kann. Genau diese Gestaltung des „hic et nunc“ geschieht im Ritual, der Fokus der Aufmerksamkeit ist auf die Gegenwart gerichtet. Das mach dem Trauernden Mut, daß er auch in Zukunft in der Lage sein wird, sein Leben zu ergreifen.
e) Auseinandersetzung im Tun
Es gibt zwei wichtige Elemente einer symbolischen Handlung. Das erste Element ist die Erfahrung, daß die Auseinandersetzung im Tun geschieht. Der aktive Prozeß des Ergreifens hilft, die Realität des Todes anzuerkennen und so einen ersten Schritt zu Integration zu leisten. Das zweite Element ist das Bemühen, die eigenen Erfahrungen in ein Form zu bringen. In einem schöpferischen Prozeß entsteht etwas Sichtbares. Inneres kann zu einer äußeren Gestalt werden, kann ausgedrückt werden.
2.„Mementoes“: Erinnerungsstücke
Wenn ein Erwachsener oder ein älteres Kind sterben, gibt es viele besondere Gegenstände, die mit Erinnerungen an den Verstorbenen verbunden sind. Ganz anders ist die Situation, wenn ein Kind tot zur Welt kommt, oder um die Geburt herum stirbt. Dann haben die Eltern und die Geschwister oft nur sehr wenige „mementoes“. Manche Familien haben keinen einzigen Gegenstand, der sie an das gestorbene Kind erinnert.
a) „Mementoes“ als Begleiter in der Trauer
„Mementoes“ können auch Gegenstände sein, die mit positiven Erfahrungen während der Trauerprozesses verbunden sind. Manchmal sind es Geschenke von Menschen, die die Eltern unterstützt haben. Gerade in Krisenzeiten können solche Übergangsobjekte stabilisierend wirken.
b) Neu geschaffene „Mementoes“
„Mementoes“ müssen nicht Gegenstände sein, die schon im Besitz der Eltern waren, als das Kind starb. Es können ebenso Dinge sein, die nach dem Tod des Kindes geschaffen und gestaltet wurden. Gerade Eltern, die kaum Gegenstände habe, die sie an eine gemeinsame Zeit mit dem Kind erinnern, erleben es oft als sehr hilfreich, wenn sie selbst etwas gestalten können, oder wenn sie nach Symbolen und Bildern für ihre Erfahrungen suchen können.
c) Kerze als Symbol des Gedenkens
Die Kerze ist ein Symbol, das die Menschheit schon sehr lange bei Feiern und besonderen Anlässen verwendet. In der christlichen Tradition steht die Kerze in einem engen Zusammenhang mit Weihnachten und Ostern. Aber auch für viele Menschen, die keine Beziehung zur christlichen Überlieferung haben, ist das Anzünden einer Kerze eine wichtige symbolische Handlung, diene besondere, außergewöhnliche Zeit markiert. Kerzen bringen Wärme und Geborgenheit, die Flamme wird auch als ein Symbol der Liebe gesehen.
Ein Vorschlag als ein Symbol für die Verwendung von Kerzen in einem Ritual wäre es, eine Kerze während der Geburt eines toten Kindes brennen zu lassen und diese Kerze den Eltern dann zu schenken. Hier kann man das Licht verstehen im Sinne einer Begleitung schon während der Geburt, eines Empfangens des toten Kindes mit Kerzenlicht auf dieser Welt und einer besonderen Kerze, die die Eltern durch ihre Trauerzeit begleiten kann. Dieser Vorschlag ist inzwischen von einigen Hebammen aufgriffen worden. Sie erzählten, daß sie positive Rückmeldungen von Eltern bekommen hätten, denen sie eine Kerze mit nach Hause gegeben hatten. Sie berichteten auch, daß sie selbst gespürt hätten, wie sich die Atmosphäre im Kreißsaal verändert, wenn eine Kerze brennt.
d)Das Fehlen von gemeinsamen Erinnerungen
Gerade in bezug auf die soziale Interaktion wird deutlich, daß die Situation nach dem perinatalen Tod eines Kindes ein ganz andre ist als die nach dem Tod eines Erwachsenen. Wenn ein Kind um die Geburt herum stirbt, gibt es beinahe keine gemeinsamen Erinnerungen, die die Eltern mit Freunden und Verwandten teilen können. Eltern eines früh gestorbenen Kinde können eben nicht sagen: „ Weißt du noch, wie unser Sohn zum erstem Mal gesessen hat?“ Solche geteilten und mitgeteilten Erinnerungen erleichtern den Trauerprozeß – und sie fehlen beim frühen Tod eines Kindes.
3.Jahrestage und andere wichtige Gedenktage
a)Meilensteine auf dem Weg durch die Trauer
Jahrestage können ein Anlaß sein, auf das vergangene Jahr zurückzublicken, vielleicht auch auf die Zeit seit dem Tod des Kindes. Dieser Rückblick kann hilfreich sein, denn während des Durchlebens des Prozesses sehen die Eltern ihre Schritte in Richtung Heilung manchmal nicht. Dies können im Überblick viel deutlicher wahrgenommen werden.
Nicht nur der Todestag des Kindes, sondern auch andere Tage können für die Eltern die Funktion von Meilenstein den haben: der errechnete Geburtstermin; in folgenden Schwangerschaften die Schwangerschaftswoche, in der das Kind gestorben ist; der eigene Geburtstag, an dem die Eltern sich erinnern, daß das Kind fehlt; und viele ganz individuelle Tage.
b)Muttertag und Vatertag
Diese Tage können besonders für Eltern, die keine lebenden Kinder habe, schwierige und traurige Tage sein. Fragen der Identität der Eltern können in dieser Zeit besonders drängend werden. In einer Veröffentlichung einer amerikanischen Selbsthilfegruppe beschreibt eine Mutter ihre Gedanken zu diesen Gedenktagen: „ Verständlicherweise sind dies zwei Tage, die von unsrer Gesellschaft bestimmt worden sind, um den Status der Elternschaft zu ehren, wie das sprichwörtliche Salz in der unseren Wunde. Für diejenigen von uns, die keine überlebenden Kinder haben, bringen diese beiden Feiertage auch viele Fragen a die Oberfläche. Wird irgend jemand, anerkennen, daß wir Eltern sind? Werden wir uns selbst erlauben, anzuerkennen, daß wir Eltern sind? Sind wir Eltern? Natürlich sind wir es! Töchter und Söhne hören nicht auf, Töchter und Söhne zu sein, wenn ihre Eltern sterben. Wir sind Mütter und Väter, deren Kinder gestorben sind.“
4. Namensgebung
a) Anerkennung des Kindes als Individualität
Der Name eines Menschen steht in engem Zusammenhang mit der Anerkennung seiner Individualität, seiner Persönlichkeit. Die fragen nach der Identität und den Wesen eines Menschen sind häufig verbunden mit dem Namen, der er trägt. Wistinghausen beschreibt diese Beziehung zwischen dem Namen und dem Wesen eines Menschen folgendermaßen: “Der Name deutet nicht nur auf den Menschen, sondern er bedeutet den Menschen. Das persönliche Wesen Mensch lebt und webt geheimnisvoll in den Lauten des Namens und äußert sich in ihnen.“
Um ein Gegenüber persönlich ansprechen zu können, müssen wir seinen Namen kennen. In diesem Sinne kann der Name auch als eine Voraussetzung für Begegnung gesehen werden.
Es erscheint uns selbstverständlich, einem lebend geborenen Kind einen Namen zu geben. Die Frage nach dem Namen ist meist auch ein der ersten Fragen, die Eltern kurz nach der Geburt eines lebenden Kindes von Freunden und Verwandten gestellt werden.
Dieser selbstverständliche Umgang mit dem Namen geht verloren, wenn das Kind tot geboren wird oder kurze Zeit nach der Geburt stirbt. In dieser Situation werden Eltern nur selten gefragt, wie ihr Kind heißt. Dabei kann die Namengebung gerade beim frühen Tod eines Kindes für die Eltern und für alle anderen Beteiligten wichtig Signale setzen. Wenn Eltern einem totgeboren oder perinatal gestorbenen Kind einen Namen geben, machen sie damit deutlich, daß ein Mensch gestorben ist, daß es nicht um den Verlust eines Schwangerschafts-Produktes geht. Diese Anerkennung der Individualität des Kindes gehört wesentlich zu einem würdevollen Umgang mit früh gestorbenen Kindern. Fast alle Mütter, die in einer Untersuchung befragt wurden, hatten ihren verstorbenen Kindern einen Namen gegeben. Viele hatten jedoch diesen Namen noch nie einem anderen Menschen gegenüber ausgesprochen. Die selbstverständlich frage nach dem Namen kann den Eltern helfen, die Schwelle zu überwinden, zum ersten Mal den Namen ihres Kindes andren mitzuteilen.
Da die Eltern so wenige konkrete Erinnerungen an ihr Kind habe, kann die Namensgebung ihnen oft helfen, anzuerkennen, daß sie um einen konkreten Menschen trauern. Der Name kann auch zu einem Symbol für die Existenz des Kindes werden. Gerade bei mehrfachen Verlusten ist es sehr wichtig, zu differenzieren – die einzelnen Verluste zu benennen, um dann trauern zu können. Nachdem Frau S. den Namen ihres Sohnes ausgesprochen hatte, konnte sie um dieses Kind trauern. Es bekam eine Gestalt, während vorher alles wie in einem schwarzen Strudel vermischt gewesen war. Mit dem Mitteilen des Namens sind zwei Erfahrungen verbunden: das Kind bekommt eine Identität, durch diese Identität ist es nicht ersetzbar.
b) “Endlich was in den Händen haben” – Zur Bedeutung von Dokumenten
Gerade wenn Eltern ihr totes Kind nicht gesehen haben, suchen sie oft nach “Mementoes”, die auf die auf die Existenz ihres Kindes hinweisen. In einer solchen Situation können formale Schriftstücke, die für Außenstehende sachlich und kühl wirken, eine wichtige Rolle spielen